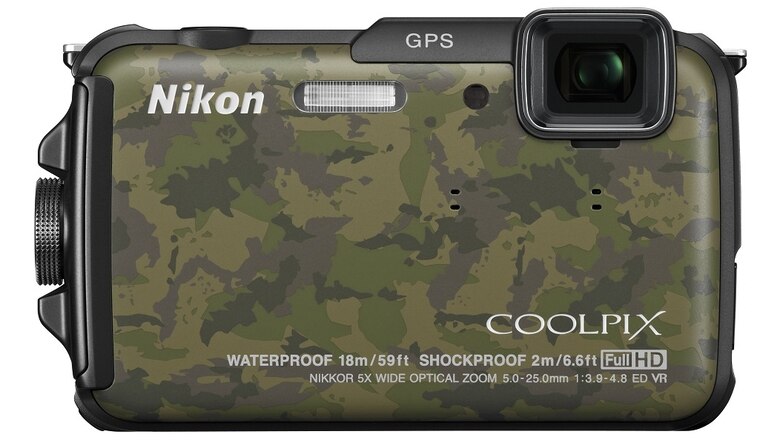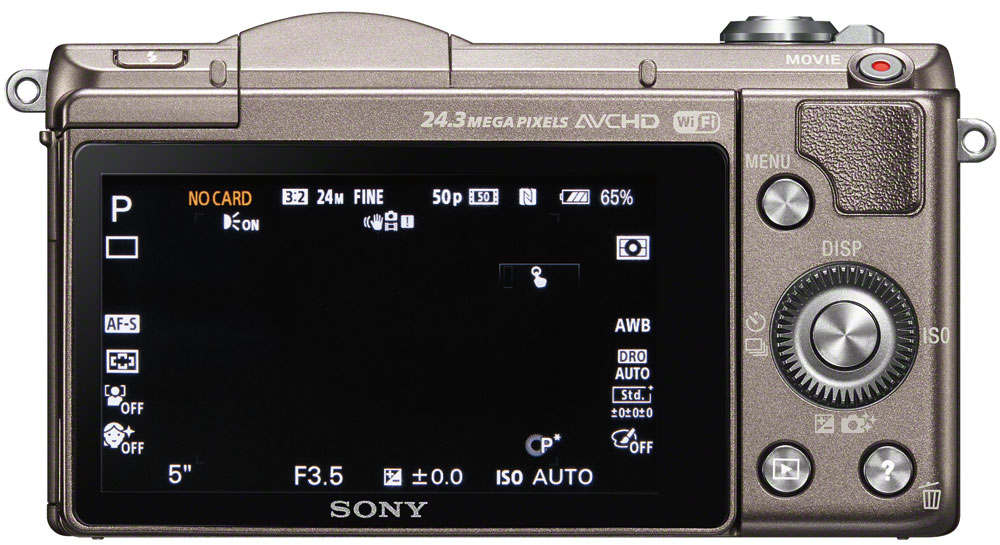Fazit: Die Panasonic Lumix DMC-LF1 gefällt im Test als ultra-kompakte Kamera mit guter Bildqualität und einem lichtstarken 7fach-Zoom. Ihr Alleinstellungsmerkmal, der elektronische Sucher, taugt in der Praxis aber nur als Notbehelf. Davon abgesehen, stecken in der LF1 alle Merkmale, über die eine aktuelle, hochwertige Kompaktkamera verfügen sollte.

Panasonic Lumix DMC-LF1 Test: Geradliniges Design (Foto: Panasonic).
Ultra-kompakte und gleichzeitig hochwertige Kameras gibt es bereits, die Canon PowerShot S110 zählt zu den populärsten Vertretern. Panasonic meint, eine weitere Nische gefunden zu haben: ultra-kompakt, hochwertig und mit einem elektronischen Sucher ausgestattet. Das kann Vorteile in schwierigen Lichtsituationen bringen, etwa wenn bei strahlendem Sonnenschein auf dem 3-Zoll-Display – bei der LF1 mit ausreichend hoher Auflösung für eine scharfe Darstellung – kaum mehr etwas erkennbar ist. Den praktische Nutzen des LF1-Suchers schränkt aber die pixelige Abbildung (Auflösung: nur 200.000 Bildpunkte) und die ruckelnde Bewegungsdarstellung ein.
LF1 im Test mit überzeugender Bildqualität
Die Bildqualität der LF1 gefällt uns dagegen. Der 12-Megapixel-Sensor mit großer Oberfläche (1/1,7 Zoll) liefert hoch auflösende und detailreiche Fotos – im Weitwinkel und im Tele. Die beste Auflösung gibt es gibt es bei ISO 80 mit 1.283 Linienpaaren pro Bildhöhe. Auch bei erhöhter ISO-Zahl stimmt die Leistung noch, selbst bei ISO 1.600 messen wir noch 1.075 Linienpaare. Zum Bildrand hin nimmt die Schärfe um rund 20 Prozent ab.
Die Abbildung feiner Details gefällt. Das ist nicht zuletzt auf das schwache Eingreifen der Rauschunterdrückung zurückzuführen. Der Haken: Bereits bei kleinster ISO-Zahl entdecken scharfe Augen erste Störpixel. Auffällig wird das Bildrauschen jedoch erst ab ISO 1.600.

Panasonic Lumix DMC-LF1 Test: Scharfes Display (Foto: Panasonic).
LF1 punktet im Test mit lichtstarkem 7fach-Zoom
Trotz kompakter Kamera-Abmessungen vergrößert das Objektiv 7fach. Dafür startet der Brennweitenbereich erst bei 28 Millimeter und lässt somit eine ultra-weitwinklige Brennweite vermissen. Im Tele erreicht das Objektiv 200 Millimeter Brennweite (entspr. Kleinbild). Ein Bildstabilisator ist vorhanden und unterstützt wirkungsvoll. Pluspunkte bei Schwachlicht bringt die hohe Lichtstärke von F2,0, die im Tele aber auf F5,9 zurückgeht.
Das Autofokus-System schärft akkurat und schnell. Auch die kurzen Wartezeiten beim Einschalten und der Bildverarbeitung überzeugen. Knapp fällt dagegen die Akku-Laufzeit aus: 100 bis 370 Fotos sind möglich.
LF1 mit WLAN und NFC ausgestattet
Die Bedienung stellt erfahrene Fotografen und Anwender mit dem Wunsch nach Automatikprogrammen gleichermaßen zufrieden. Das Objektivrad entpuppt sich in der Praxis als eine gelungene Unterstützung bei den Einstellungen. Video filmt die LF1 mit gutem Funktionsumfang in Full-HD-Auflösung. Sowohl NFC als auch WiFi zählen zum Ausstattungsumfang. Ersteres erleichtert die Koppelung mit NFC-fähigen Geräten, letzteres die Übertragung der Aufnahmen und die Fernsteuerung vom Smartphone aus.